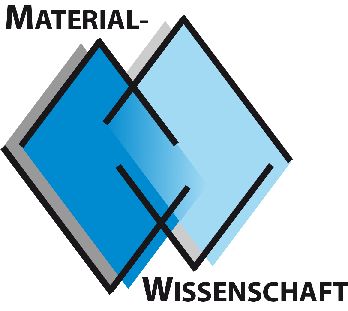Strom aus der Hibiskusblüte: Bau einer Farbstoffsolarzelle
Materialwissenschaft im Merck-Juniorlabor
16.10.2024 von Andrea-Katharina Schmidt, Ruben Bischler
Was haben Hibiskustee und Zahnpasta mit der Energiewende zu tun? Am 10. und 11. Oktober 2024 war der Chemie-Grundkurs der Q1 des Ludwig-Georgs-Gymnasiums Darmstadt zu Gast an der TU Darmstadt, um dieser Frage im Rahmen eines neuen gemeinsamen Experimentierangebots des Instituts für Materialwissenschaft und dem Merck Juniorlabor auf den Grund zu gehen.
Die Schüler:innen durften im Juniorlabor selbst Hand anlegen: In Kleingruppen bauten Sie eigene Farbstoffsolarzellen (auch bekannt als Grätzel-Zellen), untersuchten deren Mikrostruktur und testeten sie auf Funktion.
Sie begannen mit der Herstellung einer Titandioxid-Paste. Titandioxid (TiO2) findet sonst zum Beispiel Verwendung als weißes Pigment für Wandfarbe oder Kosmetikprodukte wie Zahnpasta oder Sonnencreme. Die Paste wurde dann auf ein mit einer transparenten, leitfähigen Schicht versehenes Glas aufgebracht und gesintert. Die Prozedur wurde mit einer kommerziell erworbenen, für den Bau von Grätzel-Zellen optimierten TiO2-Paste wiederholt.
Die Mikrostrukturen der beiden so hergestellten Absorberschichten konnten die Gruppen dann im Rasterkraftmikroskop (engl. atomic force microscopy, AFM) untersuchen. Hier lernten die Teilnehmenden eine wichtige Analysenmethode der Materialwissenschaft kennen, die ihnen Einblicke in die „Nanowelt“ ermöglichte.
Im nächsten Schritt kam der Hibiskustee ins Spiel. Mit diesem wurden die Titanoxid-Schichten gefärbt und damit „sensibilisiert“. Die Farbstoffe der Blüte, sogenannte Anthocyane, wandeln Lichtenergie in elektrische Energie um, sorgen also für die photovoltaische Aktivität der Zelle.
Auch die Gegenelektroden wurden von den Schüler:innen selbst hergestellt, nämlich durch Beschichtung eines weiteren Glassubstrats mit Graphit. Abschließend konnte die Solarzelle zusammengebaut und getestet werden. Durch Strom-/Spannungs-Messungen mit verschiedenen Lichtquellen wurden aussagekräftige Kennwerte für die Qualität der Zellen ermittelt.
Wie denken Materialwissenschaftler:innen?
Theoretischer Input zur Vorbereitung auf die Laborpraxis und das Besprechen der Messergebnisse waren natürlich auch Teil des Programms. So konnten die Zellperformance und die im AFM aufgedeckten Mikrostrukturen abschließend in Zusammenhang gebracht werden. Damit erarbeiteten sich die Schüler:innen die Arbeitsweise in der Materialforschung, nämlich die anwendungsorientierte Optimierung technischer Werkstoffe und das hierfür essentielle Wechselspiel zwischen Synthese und Charakterisierung.
Da es sich um die Premiere des Angebotes handelte, war das Feedback der Teilnehmenden besonders wichtig. Die Schüler:innen lieferten viele ausführliche und wertvolle Hinweise zur Optimierung des Angebots für nachfolgende Durchführungen. Die für die Konzeptionierung und Durchführung verantwortlichen Mitarbeitenden des Merck-Juniorlabors und des Instituts für Materialwissenschaft bedanken sich herzlich bei den motivierten Schüler:innen für die tolle Mitarbeit und nicht zuletzt bei ihrer engagierten Lehrerin Frau Winkelbrand.
Ab November im Regelbetrieb buchbar
Das fächerübergreifende Angebot Photovoltaik wird zukünftig Teil des regulären Juniorlabor-Programms. Aus organisatorischen Gründen findet es in zuvor festgelegten Zeiträumen statt Erste Gelegenheiten zur Teilnahme im Regelbetrieb gibt es im November 2024 in den Kalenderwochen 47 und 48.
- Zielgruppe: Chemie- und Physikkurse ab E-Phase
- Dauer: 6 h (inkl. Pause)
- Anmeldung: über das Anfrageformular